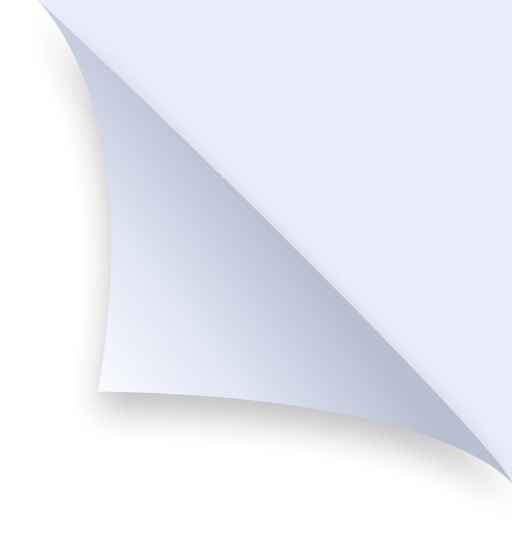Was passiert, wenn aus dem Leistungsbilanzdefizit der USA ein Überschuss wird?

Frankfurter Börsenbrief
Abgesehen von vielen sprachlosen Gesichtern bei chronischen Amerika- Hassern würde eine solche tektonische Veränderung in vielfältiger Weise wirken. Zwar konnte das US-Leistungs- bilanzdefizit bereits maßgeblich eingegrenzt werden, doch der eigentliche Aufhänger der Betrachtung ist eine stärkere Ausnutzung der erheblichen Schiefergas-Vorkommen.
Bisher ließ sich dies technologisch und auch umwelttechnisch schlecht nutzen, doch inkl. des sog. „hydraulic fracturing“ verbessern sich die Nutzungsmöglichkeiten. Bereits jetzt konnte das Verhältnis von Gasreserven zur Jahresproduktion von 8 auf 12 Jahre erweitert werden. Mit einer technologischen Weiterentwicklung wäre indes perspektivisch auch eine Reichweite von mehr als 100 Jahren denkbar sowie auch, dass die USA von einem Netto-Importeur zu einem -Exporteur von Öl aufrücken. Das wäre die entscheidende Vorzeichenveränderung. Dazu allerdings kommt potenziell ein Trend zu einer Re-Industrialisierung der USA. Je höher die Produktionskosten beispielsweise in China (als Produktionsstandort) sind, desto größer wird der Reiz, Produktion im Inland anzusiedeln oder gar zurückzuverlagern. Damit lassen sich nicht nur politische Risiken reduzieren, sondern auch die Flexibilität und Geschwindigkeit erhöhen und nicht zuletzt natürlich auch die Transportkosten (und die Umweltbelastungen im Transport) reduzieren. Wird dies zu einem Trend, würde dies die teilweise fehlerhafte Einordnung des US-Leistungsbilanzdefizits korrigieren. Die Folgewirkungen sind breit:
Bei einer ausgeglichenen Leistungsbilanz der USA entfiele eines der wesentlichen Argumente gegen den Dollar. Entsprechend wäre mit einer deutlichen Aufwertung des Greenback zu rechnen, was für die ohnehin eher binnenwirtschaftlich orientierten Amerikaner in der Wahrnehmung auch kein Problem wäre. Hiermit verbunden allerdings ist auch ein reduzierter Druck für die Notenbanken von Handelspartner-Ländern, zur Schwächung der jeweils eigenen Währung überhöhte Dollar-Bestände aufzubauen. Dies würde dann gewissermaßen der Markt von sich aus regeln. Für die Eurozone übrigens ergäbe sich eine indirekte Verbesserung in der Wettbewerbsfähigkeit.
Weniger Dollar-Reservekäufe indes bedeuten tendenziell weniger Notenbank-Käufe von amerikanischen Staatsanleihen. Zu erwarten wäre somit auch tendenziell ein Anziehen im amerikanischen Zinsniveau. Es ist durchaus denkbar, dass die Quantitative-Easing-Maßnahmen der Fed bereits sozusagen ein Fenster für derartige Anpassungen geöffnet haben. Und definitiv würde man einen Zinsanstieg nicht dem Zufall und wohl auch nur nachranging dem Markt überlassen. Ein Zinsanstieg wäre eine durchaus wünschenswerte Entwicklung, würde sie doch auf eine Normalisierung und sukzessive Gesundung nach den Wirren der Finanzkrise hindeuten. Ein höheres Zinsniveau wäre auch die logische Folge einer wirtschaftlichen Dynamisierung und entsprechender Verbesserungen am US-Arbeitsmarkt. Die Qualität von Investitionsentscheidungen und mithin die Qualität in der Kapitalallokation würde mit einem steigenden Zinsniveau tendenziell zunehmen. Das derzeitige Zinsniveau (z.B. etwa 0,9 % p.a. für 5-jährige Treasury Notes) ist ohnehin ein glatter Hohn, besonders auch in Relation zur Inflation (Januar: 2,9 %). Steigende Zinsen beim Trendsetter USA würden natürlich auch auf andere Märkte abstrahlen und tendenziell zu einem Zinsanstieg führen.
Natürlich ergeben sich auch Konsequenzen in der außenpolitischen Ausrichtung der USA. Je geringer die Abhängigkeit von Energieund Kapitalimporten, um so unabhängiger kann man außenpolitisch auftreten. Das impliziert tendenziell eine wesentlich stärker nach innen gerichtete Politik und beispielsweise auch deutlich weniger Engagement im Bezug auf die Vorgänge im Nahen/Mittleren Osten, was eher ein Thema für die Europäer wird.