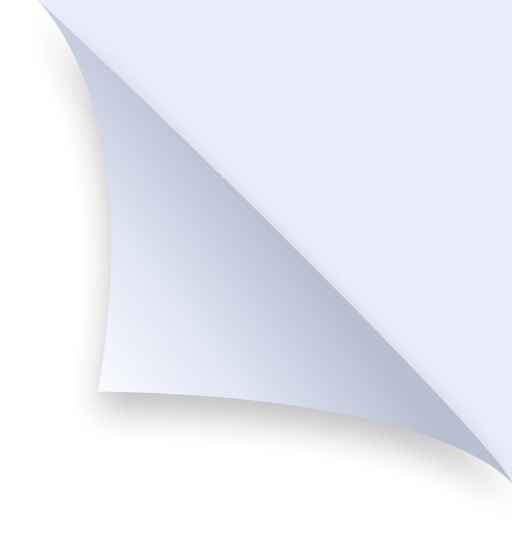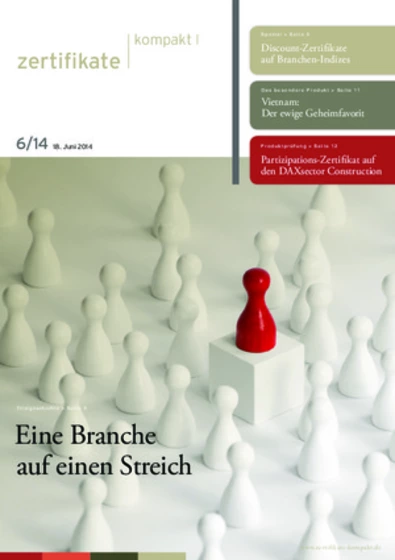Es gibt zu wenige „Sichere Häfen“ in unserer schuldengeplagten Zeit

Frankfurter Börsenbrief
Die Entzauberung der Anlageklasse „Staatsanleihe“ hat nicht nur eine Menge Verunsicherung erzeugt, sondern auch einen konkreten Anlagenotstand. Kein Wunder: In diesen Tagen verschwimmen mitunter die Grenzen zwischen Liquiditäts- und Solvenzrisiken. Der generelle Ansatz der Politik ist (noch!), Schulden mit Schulden zu bekämpfen, was aber Probleme eher vertagt als löst.
Entsprechend muss man sich über die folgerichtige Erosion von Rating-Herabstufungen nicht wundern, egal wie unbequem dies für das politische Establishment auch sein mag. Faktisch dürfte es so sein, dass ganze Länder vom Radarschirm der Anlagegesellschaften schlichtweg verschwinden. Was sind die Häfen?
Primäre Profiteure sind der deutsche und der amerikanische Markt für Staatsanleihen. Das bedeutet sowohl für Deutschland als auch die USA ein künstlich nach unten gedrücktes Zinsniveau, wenn auch in einem sehr unterschiedlichen Rahmen: Das deutsche Zinsniveau müsste theoretisch höher sein, weil die deutsche Wirtschaft regelrecht brummt. In den USA müsste das Zinsniveau höher sein, weil die Schuldenlast theoretisch auch einen höheren Risikoaufschlag im Zins erfordert. Diese beiden Asset-Klassen sind indes so liquide, dass sie auch weiterhin als sichere Häfen gesucht werden. Selbst im Falle eines technischen Defaults in den USA dürfte sich hieran paradoxerweise wenig ändern ganz einfach, weil sinnvolle Alternativen in der benötigten Marktbreite fehlen.
Einige Währungen werden von diesem Rahmen regelrecht befeuert. Wir hatten dies in der jüngsten Ausgabe schon ausführlich angeleuchtet. Die Implikationen gehen mitunter weiter, als vielen Marktteilnehmern bewusst ist. Beispiel: Der Euro verlor gegen den Franken seit dem Jahreswechsel etwa 8 %, der US-Dollar sogar ca. 12 %. Gegenüber dem Euro ergab sich in den letzten 12 Monaten eine Franken-Aufwertung von etwa 20 %. Potenzielle Verlierer dieser Situation sind natürlich die TourismusWirtschaft sowie das Exportgeschäft, denn mit der starken Eigenwährung sinkt tendenziell die Wettbewerbsfähigkeit. Dazu kommt: Viele Finanzierungen in Osteuropa sind in Franken aufgenommen, was angesichts des niedrigen Zinsniveaus reizvoll war. So gibt es in Polen grob 700.000 Immobilienfinanzierungen in Franken, was etwa 53 % der ausstehenden Kredite entspricht. In Ungarn sind etwa 64 % der Immobilienfinanzierungen und etwa 54 % der Unternehmensdarlehen in Fremdwährung aufgenommen, mit besonderem Schwergewicht des Franken. Gegen den Zloty wertete der Franken allein seit Anfang April um grob 11 % auf, gegenüber dem ungarischen Forint waren es etwa 12 %. Je teurer der Franken, desto schwerer und anfälliger wird der Schuldendienst für die Kreditnehmer. Bei den zahlreichen sehr guten Verbesserungen in Osteuropa ergibt sich damit ein rein externer Gegenwind. Denn: Der Schweizer Franken ist als Währung schlichtweg zu klein, um eine größere Menge an Fluchtkapital auffangen zu können, ohne dass es zu unerwünschten Preisverwerfungen kommt. Im Grunde gilt dies auch für den Australischen Dollar sowie auch den Neuseeland-Dollar und den südkoreanischen Won oder auch die norwegische Krone.
Eine natürliche Alternative bzw. Ergänzung ist Gold.
Zwar ist auch der Goldmarkt nicht breit genug als echter sicherer Hafen, aber er ist zumindest eine Alternative mit dem sehr konkreten Vorteil, dass sich Gold nicht über die Notenpresse vermehren lässt und politisch unabhängig ist. Dazu kommt, dass ein steigender Goldpreis nur wenige Kollateralschäden erzeugt. Kurzfristig ist die Stimmung hier überzogen optimistisch geworden, was durchaus auch mal einen temporären Rücksetzer möglich macht. Doch der längerfristige Gold-Trend bleibt weiterhin intakt und wird nicht nur von der Unsicherheit befeuert, sondern auch vom generellen Trend bei Angebot und Nachfrage, und zwar nicht nur die westliche Investmentnachfrage, sondern auch die generell sehr wichtige Nachfrage in Asien. Exemplarisch: Einjährige Einlagen bringen in China einen Zins von 3,5 %, die Inflation aber liegt bei etwa 6,4 % ein perfektes Umfeld für eine hohe Gold-Nachfrage.
Perspektivisch dürften auch einzelne Unternehmensanleihen und gegebenenfalls sogar Aktien zu sicheren Häfen werden. Hier ist viel eher eine punktuelle Kreditwürdigkeitsprüfung möglich. Und während viele Länder in Schulden ertrinken, haben zahlreiche Unternehmen geradezu überquellende Liquiditätsbestände, vielfach eine sehr überzeugende Rentabilität und mitunter auch eine günstige Bewertung, die ein Sicherheitspolster für die Kurse darstellt.