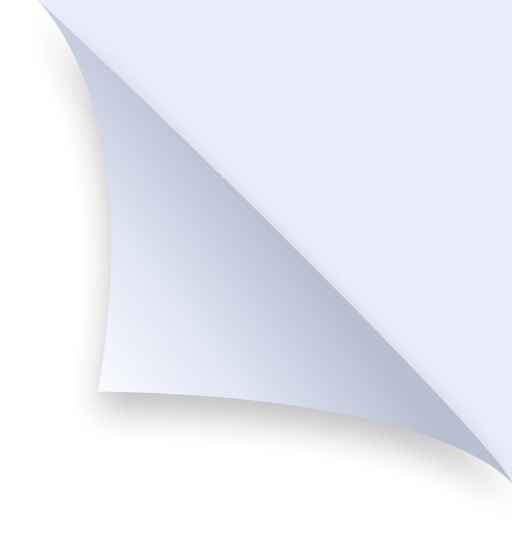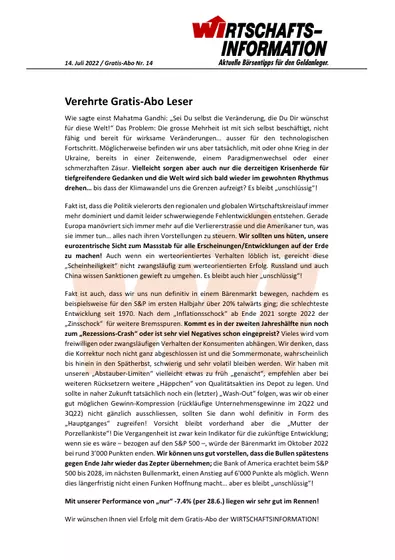Der Euro ist tot, es lebe der Euro

Veröffentlicht von
CURT L. SCHMITT Informationsdienste
am
11.05.2010
Dies ist eine exklusive Leseprobe von:
Frankfurter Börsenbrief
Die Forex-Märkte haben es seit Anfang des Jahres bereits vorweggenommen: Den Euro, wie wir ihn bisher gekannt haben, wird es nicht mehr geben. Die in sich stabile Währung brachte den Europäern einige Wohlfahrt.
Vorbild beim Bau des Euro war die D-Mark mit einer unabhängigen Zentralbank. Der Staat hielt sich aus der Währungspolitik heraus. Ein stabiler Außenwert und eine gezähmte Inflation sorgten für niedrigere Risikoprämien, was allein schon einen Standortvorteil gegenüber anderen aufstre- benden Regionen dieser Erde abgab. Bestes Beispiel: Die Euro-Staaten hatten die Bankenkrise nur in entschärfter Form zu spüren bekommen, im Vergleich zu den USA oder Groß- britannien.
Der neue Euro wird eine Staatswährung. Wie die Reichsmark zwischen 1918 und 1923 oder auch der französi- sche Franc nach 1950. Die Notenbank lässt sich an die Zügel der Politik spannen, indem sie Staatsanleihen ins Depot nimmt, um die Ziele von Barroso & Co. zu unterstützen. Das ist ein völlig anderer Ansatz als die Geldpoli- tik nach dem Muster der Bundesbank. Ab sofort werden die Regularien so verändert, dass „Bail-outs“, also das Beispringen für in Not geratene Staaten, möglich wird. Die öffentlichen Bekundungen über die Zielsetzung der Stabilität sind ein Etikettenschwindel bzw. Wunschtraum. Wie sich Währungen unter derart starker staatlicher Einflussnahme entwickeln, durften wir in Südamerika in den letzten 20 Jahren „eindrucksvoll“ beobachten.
Die ersten gewaltigen Pflöcke sind eingerammt. 750 Mrd. Euro wurden bisher bereitgestellt. Zum Vergleich: Der Bundeshaushalt war in diesem Jahr bisher mit 320 Mrd. Euro kalkuliert. Auf Deutschland lasten 960 Mrd. Euro Altschulden (nur Gesamtstaat ohne Bundesländer und Kommunen). Ausgang der Krise und Summe weite- rer Verpflichtungen ist naturgemäß ungewiss. Ein amerikanischer Kommentator sagte am Montag: „Wenn die Mutter, um das Kind, was auf zu großem Fuß lebte, aus den Schulden zu holen, eine zweite Hypothek auf das Haus aufnimmt, wird damit weder das Verhalten den Kindes geändert noch eine Aussage getroffen, wie das al- les je zurückgezahlt werden soll.“
Eine Frage der Kultur. Mit den Schulden ex- portiert Griechenland tragischerweise auch Mechanismen und Denkmuster, die Europa bis- her glücklicherweise nicht zu Eigen waren. Das fängt an mit dem Rechtsbruch. Die Verträge von Maastricht und Lissabon hatten ausdrücklich das Bail-out der Staaten untereinander verboten. De jure springt jetzt ein „special purpose vehikel“ bei Finanzbedarf ein, das sich am Kapitalmarkt sein Geld selbst besorgen muss. Durch die staatlichen Garantien ist es de facto aber doch der Einstieg in den Ausstieg aus dem Stabilitätspakt und in die Transferunion. In Frankreich (Griechenland Expos- ure 50 Mrd. der insgesamt 300 Mrd. Euro Schulden, 8,2 % Budgetdefizit, öffentliche Verschuldung 83,2 % des BIP, Arbeitslosenrate 10 %, exorbitantes Handelsdefizit) werden bereits Ausgleichszahlungen für die Wettbe- werbsunterschiede und ein EU-Finanzausgleich gefordert. Wer das bezahlen soll, braucht wohl nicht diskutiert werden. Das wollten die Väter des Euro gerade bewußt vermeiden. Wir dürfen in der Tat davon ausgehen, dass der jetzt aufgelegte Rettungs-Fonds keine Übergangs- bzw. Rettungslösung darstellt, sondern in einen Dauerzu- stand übergeht, der immer neue Begehrlichkeiten zur Verwendung des Geldes wecken wird. Der Staat wird aus- gesaugt. Bestes Beispiel ist die SoFFin, die eigentlich zur Rettung der Banken gedacht war. Jetzt, da diese Aufgabe erledigt ist, denkt man nicht etwa über eine Auflösung und Rückführung der Mittel in den Haushalt, son- dern über neue Aufgaben nach. Ein System, das Griechenland unter anderem in die Lage gebracht hat, in der es jetzt ist.
Der Staat ist kein Heilmittel. Solange die Notenbanker noch über den Euro wachten, war der Euro stabil. Wenn jetzt die Schuldenmacher sich eine Lizenz zum Gelddruk- ken geben, ist das wie der Schlüssel zum Tresorraum für Ronnie Biggs. Das Interesse des Staates an der Rettung Griechenlands ist vor allem in dem hohen Exposure eini- ger Landesbanken bzw. der ebenfalls halbstaatlichen Com- merzbank zu sehen. Während sich die anderen Geschäfts- banken erfolgreich auf das „Dealmaking“ beschränkten, luden sich die Staatsbanken enorme Risiken ins Depot. Ein Prozess, der jetzt durch das Engagement der KfW und leider auch der EZB ins Exponentielle gesteigert wird. An der Wall Street kursiert bereits als Redewendung, dass, wenn für Produkte kein Käufer gefunden werden kann, bei den deutschen Landesbanken nachgefragt werden solle. Es sind nicht die von der Politik verteufelten Speku- lanten gewesen, die die Rettungsaktion nötig machten, sondern die Landesbanken. Entsprechend wundert die Nervosität an den Märkten, dargestellt am amerikanischen Volatilitätsindex VIX, nicht.
Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Nach den Angstkursen der letzten Wochen, nachderGefahrfürdieEurozone,nachdenTurbulenzenselbstanderWallStreet,amDonnerstagletzterWo- che, die ja recht wenig mit Griechenland am Hut hatte, nach den Aussetzern am eigentlich sehr liquiden Devi- senmarkt, war natürlich auch politische Führung gefordert. Allerdings nicht, um mit viel Geld den Bail-out vor- zunehmen, mit den geschilderten hässlichen Nebenwirkungen, sondern um den Fetisch Euro zurechtzurücken. Wir hatten geschildert, wie wichtig und wertvoll eine stabile Währung ist, doch aktuell wäre eine geordnete Abwertung die bessere und billigere Lösung. Warum? Weil sich die Euro-Abwertung schon auf die mittlere Sicht nicht verhindern lässt. Wir gehen nach wie vor von weiteren Finanzlöchern in Südeuropa aus. Dann wird kein Geld mehr für Bail-outs vorhanden sein. Jede Finanzkrise der letzten 90 Jahren wurde über eine Abwer- tung der Währung und Inflation gelöst. Auch das jetzige Verschuldungsproblem ist anders gar nicht in den Griff zu bekommen. Wieso also den Umweg über teure Bail-outs, wenn die Abwertung des Euro unaufhaltsam ist? Diesen Prozess gilt es, unter Kontrolle zu halten. In den USA hat der Dollar seit Gründung der FED 90 % seines Wertes verloren. Allerdings ist die US-Industrie auch weniger exportabhängig. Dennoch ist für eine ge- wisse Zeit ein Währungsabwertung der bessere Weg als die extreme Verschuldung, die die Inflationsgefahr nur noch weiter verschärft.
Die Gewinne der DAX-Unternehmen sind wieder auf dem Vor-Krisen-Niveau ange- kommen. Nach Schätzungen der Landesbank Baden-Württemberg haben die 30 DAX-Kon- zerne im 1. Quartal 2010 insgesamt rund 17 Mrd. € verdient. Selbst in den ersten drei Monaten der Jahre 2005 und 2006 waren die Gewinne niedriger ausgefallen.
Insgesamt fallen die Gewinnanstiege deut- licher aus als das Wachstum der Umsät- ze. Hierin kommen die massiven Sparan- strengungen der Unternehmen zum Aus- druck. Allerdings ist das Einsparpotenzial nun weitestgehend ausgeschöpft, so dass für eine Fortsetzung des dynamischen Gewinnanstiegs nun zunehmend eine nachhaltige Erholung der Nachfrage von Bedeutung ist. Anders ausgedrückt: Ohne deutlichere Umsatzsteigerungen wird sich ein solches Gewinn- wachstum, wie wir es in den letzten Monaten gesehen haben, nicht mehr bewerkstelligen lassen. Wir hatten auf die zunehmende Bedeutung der Umsatzentwicklung an dieser Stelle bereits wiederholt hingewiesen.
Dies ist eine exklusive Leseprobe von: