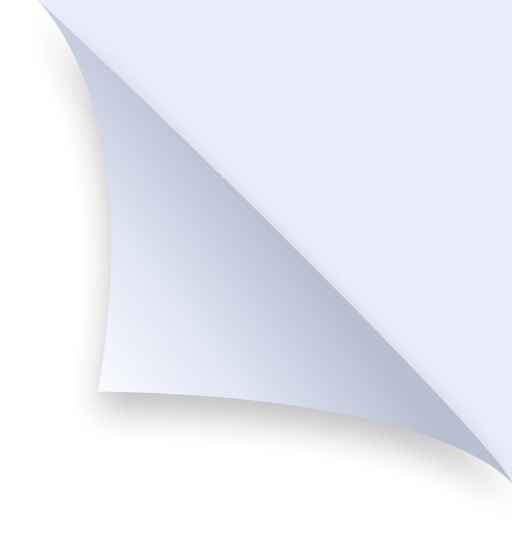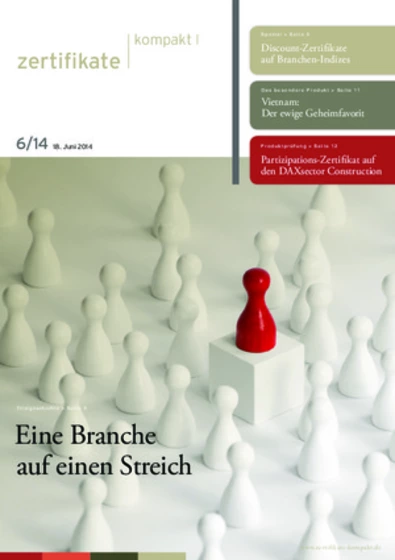Energiespeicherung wird im Zuge des Energiewandels immer wichtiger

Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne oder Wasser hat in den vergangenen Jahren einen Siegeszug sondersgleichen vollführt. Mitauslöser dieses Booms waren staatliche Subventionen für den Bau der Anlagen oder garantierte Einspeisevergütungen für den erzeugten Strom. In Deutschland beispielsweise wurde vor allem die Sonnenenergie gefördert, so dass die installierte Leistung deutscher Solaranlagen mittlerweile die der hiesigen Kohlekraftwerke übertrifft. Allerdings haben Wind- und Sonnenenergie den Nachteil, dass sie vom Wetter abhängig sind und deswegen oft auch zu Zeiten anfallen, wenn sie in dem Maße eigentlich gar nicht benötigt wird. Um die Netze nicht zu überlasten, werden paradoxerweise gerade dann ganze Wind- und Solarparks vom Netz genommen, wenn sie besonders viel Strom produzieren. Das liegt aber nicht nur an den zeitlich differierenden Angebots- und Nachfragespitzen. Auch zu kleindimensionierte oder gar nicht vorhandene Stromtrassen führen dazu, dass reichlich produzierter Wind- oder Solarstrom nicht dahin gelangt, wo er benötigt wird.
Bisher werden zur Deckung von Nachfragespitzen vor allem Kraftwerke mit fossilen Energieträgern genutzt. Gaskraftwerke sind besonders geeignet, da sie sehr schnell hochgefahren werden können. Aber auch Kohlekraftwerke werden häufig herangezogen. Speicherlösungen haben dagegen einen großen Vorteil: Sie können nicht nur zusätzlichen Strom ins Netz einspeisen, wenn dieser benötigt wird, sondern dem Netz durch Aufl aden auch Strom entziehen.
Es gibt viele technologische Ansätze, um überschüssigen Strom zu speichern. Den meisten davon fehlt aber noch die volle Marktreife. Eine Lösung wird dagegen schon seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt: Pumpspeicherkraftwerke. Da es hier aber hohe Anforderungen an die Topografie gibt und neue Projekte aber jahrelange Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen, sind Pumpspeicherkraftwerke eher als Ausnahmelösungen anzusehen, die allein das Problem nicht zu lösen imstande sind.
Lithium-Ionen-Batterien sind dagegen lediglich zum Ausgleich von kurzfristigen Schwankungen einzusetzen. Bereits heute werden Lithium-Ionen-Speicher als dezentrale Lösung in Kombination mit einer auf dem Dach installierten Solaranlage oder einem hauseigenen Blockkraftwerk eingesetzt. Allerdings sind sie mit 8.000 bis 10.000 € recht teuer. Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die sich mit dieser Technik beschäftigen. Obwohl es bereits eine Konsolidierungsphase gegeben hat, ist der Markt immer noch sehr zersplittert. Nur die wenigsten Anbieter sind börsennotiert. Darunter die Schweizerische LECLANCHÉ. Da das Unternehmen 2012 in eine Liquiditätskrise gerutscht ist und Prognosen weiterhin schwierig sind, empfi ehlt sich der Titel nicht zum Kauf.
Ein aussichtsreicher Lösungsansatz ist auch die „Power to Gas“-Technologie. Hier wird überschüssiger Strom mittels eines elektrochemischen Prozesses in Form von Wasserstoff zwischengespeichert. Dieser kann dann entweder in das Gasnetz eingespeist, oder mit Hilfe von Brennstoffzellen wieder in Strom oder durch Verbrennung in Wärme umgewandelt werden. E.ON hat im Juni im brandenburgischen Falkenhagen in der Nähe eines Windparks eine Pilotanlage mit einer Kapazität von 2 MW in Betrieb genommen. Die nächste Generation solcher Anlagen dürfte mit einer Leistung von 20 bis 50 MW aufwarten. Das kanadische Unternehmen HYDROGENICS (A1C SG9; 14,39 $) ist an der E.ON-Pilotanlage beteiligt. Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 140 Mio. € und einem Jahresumsatz von 50 Mio. $ gehört es eher zu den kleineren Vertretern der Zunft. Technologisch ist Hydrogenics aber vielversprechend. Das Unternehmen ist als Wachstumswert mit den dazugehörigen Risiken einzuschätzen. Derzeit schreibt man noch Verluste, aber bereits 2014 könnte man am Break Even schrammen. Zum Einstieg sollte ein Rücksetzer bis auf 12,75 $ abgewartet werden! CAPSTONE TURBINE und FUELCELL ENERGY sind da schon etwas weiter. Ihre Marktkapitalisierung ist doppelt bis drei Mal so hoch, während der Umsatz rund drei Mal höher als der von Hydrogenics ist. Capstone, die vor allem Mini-Gasturbinen herstellen dürften bereits in diesem Jahr am Rande der Profi tabilität stehen. Bei Fuelcell Energy, einem Hersteller von fast emissionsfreien Brennstoffzellen, wird es dagegen wohl noch bis 2015 dauern.
Für konservative Anleger bieten sich dagegen eher Aktien von Großunternehmen an, bei denen Energiespeicherung nur ein Teil des Produktspektrums darstellt. Allen voran ist hier ABB (919 730; 21,37 CHF) zu nennen, die wir im Zuge der Energiewende ja schon öfter zum Kauf empfohlen hatten. Die Schweizer haben 2012 mit dem Elektrizitätswerk des Kantons Zürich eine Batterie mit einer Maximalleistung von 1 MW in Betrieb genommen. Ebenfalls interessant ist das US-Versorgungsunternehmen AES (882 177; 12,74 €), das über seine Tochter AES Energy Storage auf dem Energiespeichermarkt aktiv ist und dort eine Schlüsselrolle einnimmt. Die Aktie ist mit einem KGV von 10 vergleichsweise niedrig bewertet. Der italienische Übertragungsnetzbetreiber TERNA (A0B 5N8; 3,19 €) ist da mit einem KGV von 14 schon etwas teuerer. Das Unternehmen ist ebenfalls in der Energiespeicherung tätig und weist eine sehr stetige Umsatz- und Gewinnentwicklung auf. Besonders attraktiv für konservative Anleger dürfte auch die hohe Dividendenrendite von 5,9 % sein.