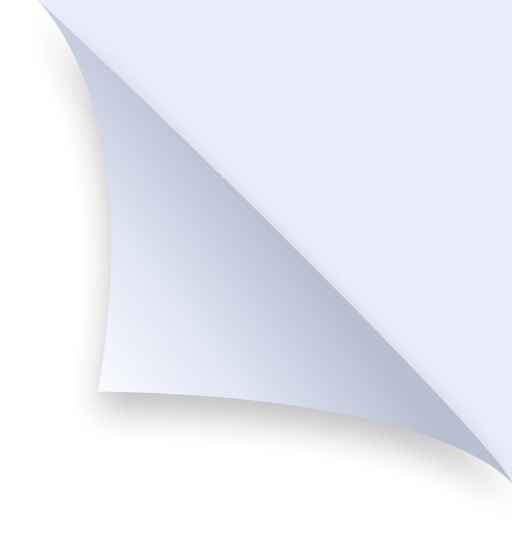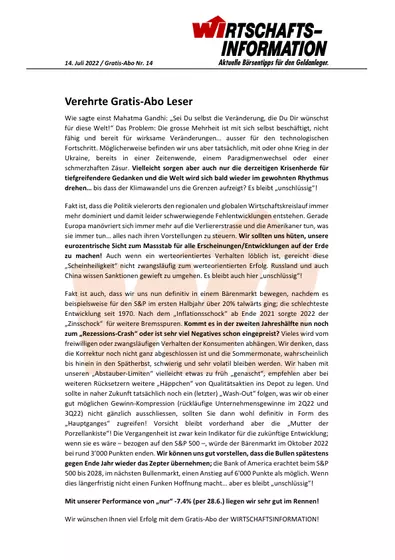Der Unternehmens-Strategien dürften demnächst mehr Biss erhalten

Frankfurter Börsenbrief
Nach der Finanzkrise inkl. derer Ausläufer sind charismatische, große Gallionsfiguren unter den Cheflenkern eher rar geworden. Insgesamt wird hervorragende Arbeit geleistet, aber dies erfolgt eher sachlich nüchtern und auch nicht so stark vorbelastet durch persönliche Eitelkeiten, die in der strategischen Prioritätenliste vor der ökonomischen Vernunft stehen.
Dies passt in den Investment-Zyklus: Nach der massiven Konjunkturkerbe im Jahr 2009 haben die Unternehmen die Profitabilität maßgeblich hochfahren können. In den entwickelten Märkten erreichte die Nachsteuermarge in jüngerer Zeit etwa 7 % des Umsatzes ein hervorragender Wert im längerfristigen Kontext. Dies ist sicherlich noch etwas ausbaufähig, wird aber zwangsläufig an natürliche Grenzen stoßen. Margenverbesserungen sind kein unendlicher Prozess, sondern segeln irgendwann gegen den Wind steigender InputKosten (also Rohstoffpreise, Frachtpreise, Personalkosten usw.). Demnächst dürften die Aktionäre also lauter werden bei der Frage, wie die Cheflenker die weitere Perspektive für Strategie und Wachstum darstellen wollen.
Wer mit zu dicker Kasse unterwegs ist, könnte sich demnächst Fantasielosigkeit vorwerfen lassen müssen. Früher waren Übernahmen ein ziemlich sicheres Rezept für unterdurchschnittliche Kursentwicklungen. Dies lag auch nahe: Bei Übernahmen und Fusionen wird ein hohes Maß an Management-Kapazität abseits des operativen Geschäfts gebunden. Diskrepanzen in den Firmen-Strukturen und -Mentalitäten werden gerne unterschätzt und Synergie-Effekte oft viel zu optimistisch veranschlagt. Für die Vergangenheit dürfte durchaus realistisch sein, dass 60 bis 70 % der Übernahmen bzw. Zusammenschlüsse eher Wert vernichteten als schufen. Das klassische Paradebeispiel ist Daimler mit dem völlig verunglückten Chrysler-Manöver, bei dem inzwischen der Schlussstrich gezogen ist. Doch muss man auch den Cheflenkern Lernfähigkeit zugestehen.
Je besser aber die Management-Qualität, um so besser ist tendenziell auch die Entscheidungsqualität bei Mergers & Acquisitions. Damit folgen die Unternehmen letztlich dem Trend, bei dem die Private Equity-Szene bereits vorausgelaufen ist. Indikativ dazu ist eine jüngere Studie der Towers Research sowie der London Cass Business School. Demnach zeigten europäische Gesellschaften, die einen Deal im Volumen von mind. 100 Mio. Dollar über die Bühne gezogen hatten, im ersten Quartal eine Performance, die um 12,2 %-Punkte besser war als der breite Markt. Etabliert sich dies als Trend, kommen zu zögerliche Cheflenker in Erklärungsnot. Dazu passt: Bisher wurden in 2011 Übernahmen im Volumen von global etwa 834,3 Mrd. Dollar verkündet, was ein Anstieg um 23 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum bedeutet und die Fahrtrichtung anzeigt.
In einem solchen Umfeld ist wieder klassische Analyse gefragt. Machen Sie es wie die Vorstände und sondieren, wo Werte am Markt einfach nicht ausreichend beachtet und bezahlt werden. Natürlich liegen die Chancen dabei vor allem in der zweiten und dritten Börsenliga, wo es traditionell weniger „Beobachtungs-Dichte“ und folglich auch noch eklatantere Bewertungsdiskrepanzen gibt. Eine zu günstige Bewertung ist dabei kein zwingender Grund für eine Übernahme. Aber je geringer der Bewertungsansatz bei möglichst hohem Cash-Bestand in der Bilanz des Zielunternehmens, um so leichter lässt sich eine Übernahme wirtschaftlich darstellen nicht nur von heimischen Unternehmen, sondern auch von internationalen Playern. Dabei sind Emerging Markets durchaus keine Einbahnstraße, und es würde nicht wundern, wenn Unternehmen aus diesem Bereich zunehmend als Subjekte auftreten.