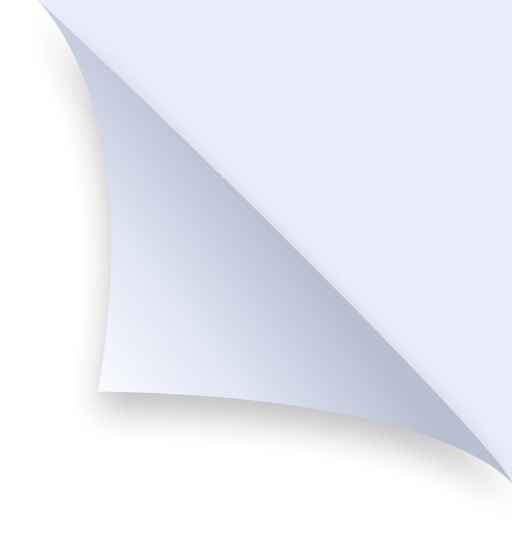Der Euro als globaler Lastenträger

Veröffentlicht von
CURT L. SCHMITT Informationsdienste
am
21.10.2009
Dies ist eine exklusive Leseprobe von:
Frankfurter Börsenbrief
Aufwertung des Euro gegen den Dollar allein seit dem März-Tief ca. 20,4 %. Kein Wunder, daß sich auf europäischer Seite Unmut regt, denn eine starke Eigenwährung bedeutet generell Nachteile in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Dabei ist der schwache Dollar zunächst vor allem das Abbild einer wieder deutlich angezogenen Risikobereitschaft der Marktteilnehmer.
Die Weltkonjunktur stabilisiert sich bzw. steht vor einem wenn auch eher trägen Wachstum, befeuert von gigantischen Hilfsprogrammen. Das Finanzsystem ist tragfähig, der Ausfall eines systemrelevanten Instituts extrem unwahrscheinlich. Doch steigende Zinsen sind angesicht der niedrigen Inflation und der immer noch wackeligen Konjunktur-Ausgangslage noch länger nicht in Sicht. Also ein Eldorado für das intern. Risikokapital. Inzwischen dürfte der Greenback die wesentliche Finanzierungswährung für Carry Trades sein, also Anlagekonstruktionen, wo man sich im Dollar verschuldet und dann höher rentierliche Anlagen wie Bonds aus Emerging Markets sucht oder auch auf steigende Rohstoffpreise setzt.
Dies dürfte ein wesentlicher Einflußfaktor für den jüngsten charttechnischen Ausbruch bei Öl sein, was, bezogen auf die freien Kapazitäten, eigentlich nicht gerechtfertigt erscheint. Durch das weltweite Überangebot an Dollar ergeben sich also wiederum preisverzerrende Effekte in verschiedenen Anlageklassen.
Für die USA ist der schwache Dollar ein Segen. Zeigte die Handelsbilanz noch gegen 2005 ein Defizit von über 6 % der Wirtschaftsleistung, so engte sich dieser Negativ-Saldo auf etwa 2,8 % im zweiten Quartal ein. Die Bekenntnisse der USA zu einem starken Dollar sind reine Lippenbekenntnisse. Vielmehr scheint (angesichts der problematischen Ausgangslage für den Konsumtrend in den USA) inzwischen ein Eckpfeiler der US-Politik eine Förderung der Exportwirtschaft zu sein, womit ein schwacher Dollar ins Konzept paßt. Außerdem bedeutet der schwache Dollar tendenziell eine importierte Inflation, die in diesem Fall gegenüber dem Deflationsrisiko aber definitiv das kleinere und sicher sogar erwünschte alternative Übel ist. Das ergibt für die USA eine komfortable Ausgangslage, zumindest solange die Abwertung in geordneten Bahnen verläuft.
China hängt durch die enge Anbindung des Renminbi am Rockzipfel der Amis. Zwar ließ man für ein Zeitfenster eine Abwertung des Renminbi zu, doch letztlich sind die Chinesen immer noch sehr aktiv im Markt. Allein im dritten Quartal wurden die Devisenreserven noch mal um 141 Mrd. Dollar hochgefahren auf grob 2.300 Mrd. Dollar. Zwar wünschen sich die Chinesen eine Diversifizierung ihrer Reserven, aber das Marktumfeld läßt dies derzeit kaum zu, so daß die Chinesen bei dem Spiel wohl oder übel weiter mitmachen müssen. Auf diese Weise profitieren sie indirekt von der Dollar-Schwäche. Ganz auf die leichte Schulter nehmen sollte man die Diversifizierungs-Bestrebungen allerdings nicht. Indikativ ist dabei, daß die globalen Notenbanken im zweiten Quartal 63 % des „frischen“ Kapitals in Euro und Yen anlegten. Der Dollar hatte eine Gewichtung von 37 %, wobei der langjährige Schnitt bei etwa 63 % lag. Sollte hieraus tatsächlich ein Trend werden, könnte dies tatsächlich zu einer langfristig bedeutenden Weichenstellung führen.
Asiatische Notenbanken werden vom Dollar-Überangebot in eine Zwickmühle gebracht. Die guten Wachstumsperspektiven der Region und die günstigen Refinanzierungszinsen in Dollar führten zu hohen Kapitalzuflüssen, womit auch die Währungen der Länder stärker aufwerteten als erwünscht. Die Notenbanken (z.B. Südkorea, Taiwan) stemmten sich mit Interventionen gegen die Aufwertung der eigenen Währungen, was allerdings die Devisenreserven deutlich hochfuhr (z.B: Südkorea allein im dritten Quartal plus 9,7 % auf 254 Mrd. Dollar). Je größer der Anstieg in der jeweiligen Geldmenge, um so stärker steigt aber auch das Inflationsrisiko. Paradoxerweise kann die Notenbank in einer solchen Lage aber nicht mit Zinserhöhungen operieren, da dies mitunter sogar noch den Zustrom spekulativen Kapitals steigern und damit das Problem verschärfen könnte.
Für Europa ergibt sich durch die Euro-Stärke ein differenziertes Bild. Länder, die es in den letzten Jahren nur unzureichend verstanden, die Produktivität und damit Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, bekommen Probleme. Je höher aber die Produktivität und der technologische Anspruch der Produkte ist, desto besser kommt man durch die Krise. So gesehen ergibt sich für Deutschland, das ohnehin etwa 80 % der Produkte in Euro fakturiert, ein eher begrenzter Bremseffekt, mit dem man unter dem Strich gut klarkommen dürfte. Durch den starken Euro dürften sich Einsparungen bei den Rohstoffeinkäufen bzw. auch bei Vorprodukten ergeben.
Fazit: Devisentrends erweisen sich häufig als bemerkenswert hartnäckig. Dabei ergeben sich differenzierte Folgen, je nach Land. Deutschland steht hier relativ gut da.
Dies dürfte ein wesentlicher Einflußfaktor für den jüngsten charttechnischen Ausbruch bei Öl sein, was, bezogen auf die freien Kapazitäten, eigentlich nicht gerechtfertigt erscheint. Durch das weltweite Überangebot an Dollar ergeben sich also wiederum preisverzerrende Effekte in verschiedenen Anlageklassen.
Für die USA ist der schwache Dollar ein Segen. Zeigte die Handelsbilanz noch gegen 2005 ein Defizit von über 6 % der Wirtschaftsleistung, so engte sich dieser Negativ-Saldo auf etwa 2,8 % im zweiten Quartal ein. Die Bekenntnisse der USA zu einem starken Dollar sind reine Lippenbekenntnisse. Vielmehr scheint (angesichts der problematischen Ausgangslage für den Konsumtrend in den USA) inzwischen ein Eckpfeiler der US-Politik eine Förderung der Exportwirtschaft zu sein, womit ein schwacher Dollar ins Konzept paßt. Außerdem bedeutet der schwache Dollar tendenziell eine importierte Inflation, die in diesem Fall gegenüber dem Deflationsrisiko aber definitiv das kleinere und sicher sogar erwünschte alternative Übel ist. Das ergibt für die USA eine komfortable Ausgangslage, zumindest solange die Abwertung in geordneten Bahnen verläuft.
China hängt durch die enge Anbindung des Renminbi am Rockzipfel der Amis. Zwar ließ man für ein Zeitfenster eine Abwertung des Renminbi zu, doch letztlich sind die Chinesen immer noch sehr aktiv im Markt. Allein im dritten Quartal wurden die Devisenreserven noch mal um 141 Mrd. Dollar hochgefahren auf grob 2.300 Mrd. Dollar. Zwar wünschen sich die Chinesen eine Diversifizierung ihrer Reserven, aber das Marktumfeld läßt dies derzeit kaum zu, so daß die Chinesen bei dem Spiel wohl oder übel weiter mitmachen müssen. Auf diese Weise profitieren sie indirekt von der Dollar-Schwäche. Ganz auf die leichte Schulter nehmen sollte man die Diversifizierungs-Bestrebungen allerdings nicht. Indikativ ist dabei, daß die globalen Notenbanken im zweiten Quartal 63 % des „frischen“ Kapitals in Euro und Yen anlegten. Der Dollar hatte eine Gewichtung von 37 %, wobei der langjährige Schnitt bei etwa 63 % lag. Sollte hieraus tatsächlich ein Trend werden, könnte dies tatsächlich zu einer langfristig bedeutenden Weichenstellung führen.
Asiatische Notenbanken werden vom Dollar-Überangebot in eine Zwickmühle gebracht. Die guten Wachstumsperspektiven der Region und die günstigen Refinanzierungszinsen in Dollar führten zu hohen Kapitalzuflüssen, womit auch die Währungen der Länder stärker aufwerteten als erwünscht. Die Notenbanken (z.B. Südkorea, Taiwan) stemmten sich mit Interventionen gegen die Aufwertung der eigenen Währungen, was allerdings die Devisenreserven deutlich hochfuhr (z.B: Südkorea allein im dritten Quartal plus 9,7 % auf 254 Mrd. Dollar). Je größer der Anstieg in der jeweiligen Geldmenge, um so stärker steigt aber auch das Inflationsrisiko. Paradoxerweise kann die Notenbank in einer solchen Lage aber nicht mit Zinserhöhungen operieren, da dies mitunter sogar noch den Zustrom spekulativen Kapitals steigern und damit das Problem verschärfen könnte.
Für Europa ergibt sich durch die Euro-Stärke ein differenziertes Bild. Länder, die es in den letzten Jahren nur unzureichend verstanden, die Produktivität und damit Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, bekommen Probleme. Je höher aber die Produktivität und der technologische Anspruch der Produkte ist, desto besser kommt man durch die Krise. So gesehen ergibt sich für Deutschland, das ohnehin etwa 80 % der Produkte in Euro fakturiert, ein eher begrenzter Bremseffekt, mit dem man unter dem Strich gut klarkommen dürfte. Durch den starken Euro dürften sich Einsparungen bei den Rohstoffeinkäufen bzw. auch bei Vorprodukten ergeben.
Fazit: Devisentrends erweisen sich häufig als bemerkenswert hartnäckig. Dabei ergeben sich differenzierte Folgen, je nach Land. Deutschland steht hier relativ gut da.
Dies ist eine exklusive Leseprobe von: